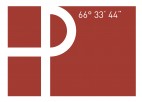Minderheiten in Norwegen: Waldfinnen (skogfinner)
 Die Waldfinnen gehören seit 1998 zu den fünf anerkannten nationalen Minderheiten Norwegens, welche nach der Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats von der norwegische Regierung als solche erklärt wurden.
Die Waldfinnen gehören seit 1998 zu den fünf anerkannten nationalen Minderheiten Norwegens, welche nach der Unterzeichnung des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarats von der norwegische Regierung als solche erklärt wurden.
Als Waldfinnen wird die Bevölkerungsgruppe bezeichnet, die am Ende des 16. Jahrhunderts von Finnland nach Schweden und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert weiter in den südöstlichen Teil Norwegens einwanderte. Wie viele Nachkommen dieser Einwanderer es heutzutage in Norwegen gibt, ist nicht bekannt. Etwa 10.000 bekennen sich derzeit zu dieser Minderheit…
Die Ostfinnen hatten von slawischen Völkern die Technik des Brandrodens übernommen, welche in den dichten, unbewohnten Nadelwäldern die geeignetste war, um den Boden für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. In die warme, nährstoffreiche Asche wurde eine spezielle Roggenart, der sogenannte svedjerug, ausgesät. Die Erträge waren gut, ließen aber schon nach wenigen Jahren nach, so dass weitere Waldflächen abgebrannt werden mussten. Dadurch entstand eine Wanderung in immer neue Gebiete.
Rund 12.000 Finnen wanderten so in Richtung Westen nach Mittelschweden. Der schwedische König Karl IX. begrüßte die Einwanderungswelle als Quelle für neue Steuereinnahmen.
Es wird geschätzt, dass 2.000 – 3.000 Finnen um 1640 von Schweden aus nach Südnorwegen einwanderten. Sie ließen sich zunächst in einem Gebiet nahe der Grenze nieder, das heute Finnskogen (Finnenwald) genannt wird. Später besiedelten sie auch Orte weiter westlich bis hin zur Telemark. Der Anteil der finnischen Bevölkerung war insbesondere im Finnskogen so groß, dass in einigen Orten bis ins 20. Jahrhundert die finnische Sprache bedeutender war als Norwegisch.
 Typisch für die Kultur der Waldfinnen ist ihre Sprache, sie sprechen einen alten savoischen Dialekt, der Baustil, typische Gebäude sind Røykstua (Rauchstube, diente als Wohnzimmer), Badstua (Sauna) und Ria (Scheune), sowie die Bewirtschaftung des Bodens durch Brandrodung. Im Gegensatz zu den Norwegern nutzten sie Öfen ohne Schornsteine, die eine sehr gute Wärmenutzung gewährleisteten.
Typisch für die Kultur der Waldfinnen ist ihre Sprache, sie sprechen einen alten savoischen Dialekt, der Baustil, typische Gebäude sind Røykstua (Rauchstube, diente als Wohnzimmer), Badstua (Sauna) und Ria (Scheune), sowie die Bewirtschaftung des Bodens durch Brandrodung. Im Gegensatz zu den Norwegern nutzten sie Öfen ohne Schornsteine, die eine sehr gute Wärmenutzung gewährleisteten.
Da die Brandrodungen enorme Waldflächen vernichteten, waren die Norweger, die das Holz der Wälder für den Eigenbedarf und den Export brauchten, eher erbost über die neuen Bewohner. Es kam zu Diskriminierungen und Streit. Die Waldfinnen passten sich an, viele verdingten sich als Holzfäller und Förster und stellten die Brandrodungen ein. Nicht wenige hörten aus Angst vor Demütigungen auf, ihre Sprache und Bräuche zu pflegen.
Seit den 1970er Jahren gab es eine Wiederbelebung der finnischen Kultur unter anderem erkennbar an der steigenden Anzahl finnischer Vornamen, einem wachsenden Interesse am Erlernen der finnischen Sprachen, der Ausschilderung mit finnischen Ortsnamen und dem Aufleben des Kontakts zwischen den Organisationen der Waldfinnen in Norwegen, Schweden und Finnland. Das Norsk Skogfinsk Museum (Norwegisches Waldfinnen-Museum) nimmt in dieser Zusammenarbeit eine zentrale Rolle ein.
Jedes Jahr im Sommer werden die Finnskogdagene in Grue (Hedmark), dem “Herz des Finnskogen” veranstaltet. Mehrere tausend Besucher kommen dann, um mit den Waldfinnen am Erhalt ihrer Traditionen und Werte teilzuhaben.
Weitere Infos unter:
skogfinner.no
www.finsk.no
www.skogfinskmuseum.no
(Fotos: www.finnskogdagene.no)
Ähnliche Beiträge:
Fosen - historische Landschaft im Trøndelag
Administrativ umfasst Fosen in der Regel die Kommunen Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Roan und Osen in Sør Trøndelag und Leksvik in Nord Trøndelag. Diese bedecken eine Gesamtfläche von etwa 3.225 km². Im Mittelalter wurden auch die Gebiete, die südlich des Trondheimsfjords liegen, zum Distrikt hinzugezählt. Fosen gehörte damals zur Provinz Nordmøre.
Früher war die Region ein bedeutendes Fischfanggebiet, das aber nach und nach an Bedeutung verloren hat. Zu Beginn der 1930er Jahre verschwanden die jährlich vorbeiziehenden Herings- und Kabeljauschwärme und mit ihnen die Grundlage für reiche Fänge. Heute sind der Anbau von Muscheln und die Aufzucht von Fischen und Krustentieren noch weit verbreitet. Die größten Arbeitgeber sind aber das Militär und die Werft in Rissa.
Die Küste ist zerklüftet von vielen, meist kurzen Fjorden. Stjørnfjord im Südwesten, Åfjord im Westen und Verrasund im Osten sind die längsten. Das Land am Meer zeigt sich nackt und flach mit Streifen von Ackerland durchbrochen. Ørland im Südwesten ist ein zusammenhängendes Flachland mit gutem Boden. Das Innere des Landes ist bedeckt von waldigen Hügeln, Moor und zahlreichen kleinen Seen. Der höchste Gipfel ist Finnvollheia (675 m). Der Berg liegt in Åfjord, an der Grenze zwischen Süd und Nord Trøndelag.
Entlang der Küste Fosens könnt ihr das typische Leben des Küstenvolkes hautnah spüren. Interessant ist das Museum Kystens Arv (Das Erbe der Küste) in Rissa. Auch Touren mit dem Kanu durch den Schärengarten oder Seeadler-, Robben- und Seevögelsafaris werden geboten. Egal, ob ihr Meeres- oder Seefische angeln wollt, hier habt ihr die Möglichkeit zu beidem.
Weitere Infos: