Niels Henrik Abel – das norwegische Genie
 In den Aufzeichnungen seines Lehrers fand man die Bemerkung „… dass er der größte Mathematiker der Welt werden kann, wenn er lange genug lebt.“.
In den Aufzeichnungen seines Lehrers fand man die Bemerkung „… dass er der größte Mathematiker der Welt werden kann, wenn er lange genug lebt.“.
Nun, lange gelebt hat Niels Henrik Abel leider nicht, aber zu einem der größten Mathematiker seiner Zeit und zum größten Norwegens ist er geworden…
Als zweites von sieben Kindern eines Landpastors wurde Niels Henrik Abel am 05.08.1802 auf Finnøy (Rogaland) geboren. Anfangs unterrichtete der Vater ihn und seine Geschwister. Ab dem 13. Lebensjahr durfte Abel zusammen mit seinem größeren Bruder Hans Mathias an die Domschule in Kristiania (heute Oslo) gehen. Hier traf er auf seinen Lehrer und großen Förderer Bernt Michael Holmboe. Er gab Niels Henrik Abel Schriften von Mathematikern wie Gauß, d’Alembert, Lagrange zu lesen, die dieser verschlang und in unglaublich kurzer Zeit darauf basierend eigene Untersuchungen anzustellen begann. Seine soziale Situation indes verschlechterte sich extrem. Er war völlig mittellos, sein Elternhaus war hoch verschuldet, sein Vater starb 1820, und sein Bruder wurde durch Krankheit erwerbsunfähig.
Trotz allem wurde Niels Henrik Abel 1821 an der Universität Kristiania immatrikuliert. Holmboe hatte ihm kostenlose Unterkunft an der Universität verschafft. Unterstützt durch Freunde und Verwandte konnte sich Abel über Wasser halten. Freundschaftlichen Rat und Familienanschluss fand er bei Professor Hansteen. Dieser war der Herausgeber der ersten wissenschaftlichen Zeitschrift Norwegens namens Magazin for Naturvidenskaberne (Magazin für Naturwissenschaften). Hier veröffentlichte Niels Henrik Abel seine ersten Artikel, die die typischen Züge eines Autodidakten tragen, aber auch die eines reifenden Genies. Sein großes Interesse galt den elliptischen Funktionen und den algebraischen Gleichungen. Auf diesen beiden Gebieten ist er schließlich auch in die Geschichte eingegangen.
Ende 1823 wies Abel nach, dass die Auflösung der allgemeinen Gleichung fünften Grades in Radikalen nicht möglich ist. Er hatte seine erste bedeutende mathematische Entdeckung gemacht. Die Universität tat ihr Möglichstes, um Abel zu fördern. 1824 wurde ihm ein bescheidenes, aber ausreichendes Stipendium gewährt. Außerdem wurden finanzielle Mittel bereitgestellt, die es ihm ermöglichen sollten, auf einer Reise die wichtigen mathematischen Zentren zu besuchen. Diese Reise startete im Sommer 1825 und führte Niels Henrik Abel über Kopenhagen und Hamburg nach Berlin, wo er den Winter verbrachte. In Berlin wurde er herzlich aufgenommen vom Oberbaurat A. L. Crelle. Crelle war ein bedeutender und einflussreicher Ingenieur und Herausgeber des Journal für die reine und angewandte Mathematik. Abel arbeitete in den knapp vier Monaten, die er in Berlin verweilte, sechs Abhandlungen für diese Zeitschrift aus, von denen zwei als Meilensteine in der Geschichte der Mathematik gelten – der Beweis der Unmöglichkeit der algebraischen Auflösbarkeit der allgemeinen Gleichungen, welche den vierten Grad übersteigen und die Abhandlung über die binomische Reihe (Abelscher Stetigkeitssatz).

Vigelands Abel-Monument auf
dem sogenannten Abelhaugen
im Osloer Schlosspark
Foto: Vigeland-museet
Abels Reise führte weiter über Freiberg, Dresden, Wien, Venedig und schließlich im Juli 1826 nach Paris, der damaligen Hauptstadt der Mathematik. Gerade in Paris wurden aber Abels Erwartungen nicht erfüllt. Die französischen Mathematiker wollten ihn nicht empfangen. Ein an den großen Cauchy übergebenes Manuskript mit der “Untersuchung über eine allgemeine Eigenschaft einer sehr verbreiteten Klasse transzendenter Funktionen” (Abelsches Theorem) wurde verlegt. Erst lange nach Abels Tod kam es wieder zum Vorschein, und die bedeutenden Erkenntnisse wurden öffentlich.
In Paris erhielt er auch weitere Anregungen für das zweite ihn besonders interessierenden Gebiet – die Theorie der elliptischen Integrale. Auch die Gruppentheorie, Abel gilt als einer der Begründer dieser (Abelsche Gruppe), nahm hier erste Formen an.
Mit reichem wissenschaftlichem Gewinn, aber ohne die erhoffte offizielle Anerkennung verließ Abel Ende 1826 frustriert Paris. Über Berlin, wo sich Crelle wieder seiner annahm, ohne ihm jedoch eine halbwegs vernünftige Anstellung bieten zu können, kehrte Abel 1827 nach Norwegen zurück. Hier fand er lediglich eine Lehramtsstelle an einer neugegründeten Militärakademie und vorübergehend eine Aushilfsstelle an der Universität. Eine feste Anstellung an der Universität in Kristiania blieb ihm verwehrt. Das Schlimmste aber war die Diagnose Tuberkulose, ein Todesurteil in der damaligen Zeit. Einzig die Mathematik gewährte ihm Ausgleich für alle Kümmernisse. Um den Jahreswechsel 1828/1829 verschlechterte sich Abels Gesundheitszustand sehr rasch. Auch die Pflege bei Freunden in Froland (Aust-Agder) half nicht mehr. Er verstarb am 06.04.1829 im Alter von nur 26 Jahren.
Zwei Tage später traf ein Brief mit der Berufung Niels Henrik Abels an die Berliner Universität ein. Endlich hätte er eine angemessene Anstellung gehabt.
1881 wurden die gesammelten Werke von Niels Henrik Abel veröffentlicht. 1908 wurde Gustav Vigelands Abel-Monument im Schlosspark in Oslo feierlich enthüllt. Zu seinem 200. Geburtstag wurde von der norwegischen Regierung die Abel-Stiftung ins Leben gerufen, die seitdem jedes Jahr den hoch dotierten Abelspreis verleiht. Die Mathematikolympiade für Schüler in Norwegen ist auch nach Niels Henrik Abel benannt: Abelkonkurransen.
Weitere Infos:
Niels Henrik Abel i Store norske leksikon
www.forskning.no
www.abelprisen.no
Ähnliche Beiträge:
Hinterlasse eine Antwort
Senja - die Märcheninsel Norwegens
 Senjas durch Fjorde tief zerklüftete West- und Nordküste mit ihren bis zu 1.000 m hohen, spitzen Felswänden, die steil aus der Brandung ragen, gehört zu den wildesten und kuriosesten Landschaften Norwegens. Der Süden der Insel ist im Gegenteil eher durch sanfte, grüne Landstriche geprägt. Diese unterschiedlichen Landschaftstypen, die hier vorzufinden sind, gaben der Insel auch den Beinamen Norge i miniatyr…
Senjas durch Fjorde tief zerklüftete West- und Nordküste mit ihren bis zu 1.000 m hohen, spitzen Felswänden, die steil aus der Brandung ragen, gehört zu den wildesten und kuriosesten Landschaften Norwegens. Der Süden der Insel ist im Gegenteil eher durch sanfte, grüne Landstriche geprägt. Diese unterschiedlichen Landschaftstypen, die hier vorzufinden sind, gaben der Insel auch den Beinamen Norge i miniatyr…
Senja ist mit 1586 km² Norwegens zweitgrößte Festlandsinsel. Sie liegt etwa 350 km nördlich des Polarkreises in der Provinz Troms und ist in vier Kommunen aufgeteilt – Berg, Tranøy, Torsken und Lenvik. Knapp 9.000 Einwohner leben hier. Alle Siedlungen sind durch Straßen erreichbar (RV 860 und RV 861). Zwischen der Insel und dem Festland besteht eine Brückenverbindung von Silsand nach Finnsnes (RV 86).
Senja wird umschlossen vom Fjord Malangen im Nordosten, dem schmalen Gisundet im Osten, Solbergfjorden und Vågsfjorden im Süden und vom offenen Meer. Zwischen den hohen Felsen liegen schmale, tiefe, abgeschlossene Täler. Der höchste Berg ist mit 985 m der Breitinden im Norden der Insel.Die gesamte Gegend ist sehr wasserreich, und so sind auch weitläufige Sumpfflächen zu finden.
Im südwestlichen Teil der Insel liegt der Nationalpark Ånderdalen, der zuletzt im Jahre 2004 auf 125 km² vergrößert wurde. In diesem könnt ihr eine Menge fischreicher Seen, Wasserfälle, dichte, unberührte Wälder und bis zu 500 Jahre alte Nadelbaumriesen entdecken. Über 90 Vogelarten wurden beobachtet, Elche durchstreifen das Gebiet, Rotfuchs, Hasen, Hermelin und Otter sind hier zu hause. Sehr beliebt bei Jung und Alt ist ein Besuch im Hulder og trollparken, eins der meist besuchtesten Touristenziele in der Provinz Troms. Seine Existenz verdankt der Park den alten Legenden und Märchen, die von den Trollen und Geistern erzählen, die die Insel bevölkern. Mit 17,96 m steht hier der größte Troll der Welt – der Senjatrollet.
Sehenswert ist auch der alte Fischerort Hamn i Senja mit seiner wunderschönen Umgebung und den historischen Kaianlagen. Das fand auch Innovation Norway, die den Ort zu einem der attraktivsten Reiseziele Norwegens kürte. Seine Blütezeit hatte der Ort im 19. Jahrhundert, heute lebt er vom Tourismus.
Bekannt ist auch der Aussichtspunkt Tungeneset mit der 1-Millionen-Toilette und Blick auf “Die Zähne des Teufels” (Djevelens tanngard), eine sehr einprägsame Felsformation.
Weitere Infos unter:
www.destinasjonsenja.no
turliv.no/senja
www.senjatrollet.no
(Fotos: M. Jürgensen)







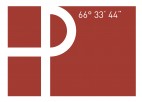






Pingback: Ingebrigt Vik - ein norwegischer Bildhauer - Norwegenstube
Pingback: Sophus Lie - bedeutender norwegischer Mathematiker - Norwegenstube