Henrik Wergeland – norwegischer Dichter und Nationalist
Neben der Lyrik und Prosa interessierte er sich aber auch für die Musik, Medizin, Biologie und die Geschichte der Literatur. Er übte mehrere Jahre lang den Beruf des Priesters aus, bevor er zum ersten norwegischen Riksarkivaren (Reichsarchivar) ernannt wurde. Er war der erste Dichter in Norwegen, der Verse für Kinder schrieb. Die Literatur dem ganzen Volk zugänglich zu machen, war ein weiteres Hauptanliegen Henrik Wergelands…
Henrik Arnold Wergeland wurde am 17. Juni 1808 in Kristiansand geboren. Sein Vater Nicolai Wergeland war Priester und Politiker. Als Henrik neun Jahre alt war, zog die Familie nach Eidsvoll, dem Ort, in dem am 17. Mai 1814 die erste norwegische Verfassung angenommen wurde. Dieses Ereignis fesselte ihn schon früh, und heute ist er aus der Geschichte des 17. Mais nicht mehr wegzudenken. Von 1819 – 1825 besuchte er die Katedralskolen in Kristiania (heute Oslo). Hier begann er mit dem Schreiben von Novellen, Theaterstücken und Gedichten. Die erste Veröffentlichung einer Erzählung gelang ihm am 17. Juli 1821 im Morgenbladet. Ab 1925 studierte Wergeland in Kristiania Theologie. Er nahm rege am Studentenleben teil, war eifrig bei der Organisation der Feierlichkeiten zum 17. Mai dabei und veröffentlichte unter dem Pseudonym Siful Sifadda mehrere satirische Texte. Vor allem aber schrieb er lyrische, Natur- und Liebesgedichte.
Im Jahre 1829 erschien Henrik Wergelands brillantes Werk Digte, første Ring. Im gleichen Jahr beendete er erfolgreich sein Theologiestudium. Er reiste durch Norwegen und eröffnete öffentliche Bibliotheken mit gespendeten Büchern. Er selbst brachte Lehrbücher für Geschichte und Botanik, ein Lesebuch für Kinder und mehrere Hefte (For Almuen) heraus, die Wissen an das Volk vermittelten. Nebenher kämpfte er für die kulturelle und sprachliche Unabhängigkeit von Dänemark. Wichtig war auch sein Einsatz für die Reformierung der norwegischen Sprache. Vorschläge, die er machte, um die Sprache zu vereinfachen und Wörter zu kürzen, wurden in späteren Rechtschreibreformen aufgegriffen.
Sein Priesteramt wurde ihm von der Regierung wegen “Ungehorsam” entzogen. 1834 schrieb er sich als Medizinstudent ein, gab das Studium zwei Jahre später aber wieder auf. 1835 veröffentlichte er sein bestes Theaterstück Barnemordersken. Von 1835 – 37 war er zudem Redakteur der Zeitung Statsborgeren, ein radikal-demokratisches Oppositionsblatt. In den darauffolgenden Jahren erreichte er seinen Höhepunkt als Dichter. 1839 heiratete er Amalie Sofie Bekkevold. 1840 folgte die Ernennung zum ersten Riksarkivaren Norwegens. Dass er nun vom König bezahlt wurde, brachte ihm nicht wenig Kritik auch von Freunden ein. Das Amt bekleidete er bis zu seinem Tod am 12. Juli 1845 in Kristiania. Er ist auf dem Friedhofshain Unser Heiland (Vår Frelsers Gravlund) in Oslo begraben.
Weitere Infos:
Henrik Wergeland i Norsk biografisk leksikon
www.wergeland2008.no
www.wergelandogstortinget.no
Ähnliche Beiträge:
Hinterlasse eine Antwort
Nordhordland - im Land der Fjorde und Berge

Nordhordlandsbrücke, Foto: www.firda.no
Heutzutage werden neun Kommunen zum nördlichen Teil Hordalands gezählt: Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjord, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy und Vaksdal. Auf einer Fläche von 2.684 km² leben hier rund 46.000 Einwohner. Als das regionale Zentrum gilt Knarvik, die Hauptstadt der Kommune Lindås. Viele Nordhordländer nutzen aber auch die Nähe zu Bergen, sei es als Arbeitsort oder nur zum Einkaufen. Neben den traditionellen Gewerken in der Fischerei, Landwirtschaft und im Handel lebt die Region auch mehr und mehr von der Ölindustrie. In Vaksdal befindet sich die größte Strickwarenfabrik Norwegens.
Der Begriff Nordhordland leitet sich vom mittelalterlichen Nordhordlen ab. Das Nordhordlen war ein Gebiet, das die Küsten- und Fjordareale des nördlichen Hordalands vom Korsfjord im Süden bis zum Sogne-See im Norden umfasste. Ab 1595 gehörte es zum Bezirk Nordhordland og Voss, ab 1857 zu Nordhordland.
Die Landschaft ist bergig, aber die Berge sind nicht so hoch wie in Sunnhordland. Nur in den Kommunen Masfjord und Modalen findet ihr welche, die höher als 1.000 m sind. Der Runderabben ist mit 1.292 m die höchste Erhebung. Etwa die Hälfte des Distrikts liegt über 300 m über dem Meeresspiegel. Der Verlauf der Fjorde ist stark geprägt von den Bergzügen und typischerweise von Nordwesten nach Südosten.
Wichtige geschichtliche Orte sind die Hamre– Kirche in Osterøy, die einst als Hauptkirche der Region galt, und das königliche Anwesen sowie der königliche Hügel in Seim mit dem Grab von Håkon der Gute.
Weitere Infos zu Nordhordland:







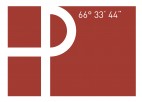




Pingback: Minderheiten in Norwegen: Juden (jøder) - Norwegenstube
Pingback: Camilla Collett - norwegische Dichterin und Feministin - Norwegenstube